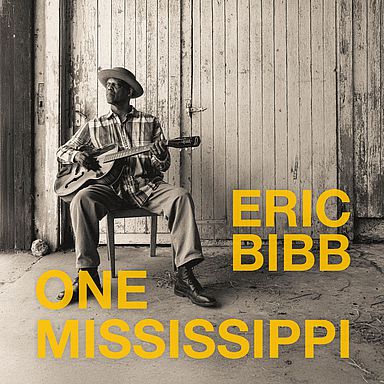Noch vor dem ersten Coronalockdown im April 2020, wurde "… e-scooter deine Liebe" als Vorabsong aus "Beton & Ibuprofen" ausgekoppelt. Die Textpassage "Denn wenn du deine Sonne siehst/Dann will sie dir was sagen/Sei immer einen Schritt schneller als die Depression" passt nach wie vor. Erstaunlich oder?
Die Songs sind vor dem Lockdown geschrieben, das Album war fast fertig produziert. Die Textstelle "Sei immer einen Schritt schneller als die Depression", beschränkt sich nicht auf die Pandemiesituation. Das ist ein universeller, ein sehr schöner Satz, der eine Bewegung hat, eine krasse Aussage trifft. Mir fiel es schwer, das Wort Depression zu singen, es mit einer Leichtfüßigkeit so hinzuwerfen. Ich war mir unsicher, ob ich das darf oder die Krankheit ins Lächerliche gezogen wird. Ich fand es dann okay und bin froh, es riskiert haben.
Durch den Beat, die Melodie, durch die gesamte musikalische Aufbereitung, wirkt der Song überhaupt nicht depressiv, eher heiter.
Dinge zu benennen ist generell etwas anderes als der Zustand selbst. Über etwas zu singen, macht es leichter, bringt Luft unter die Flügel. Bei "Beton & Ibuprofen" war es schon so, dass ich allgemein die Düsternis, die Schwere, den Schmerz ausloten wollte. Der Arbeitstitel des Albums lautete "Society Of Depression". Aber jede Musik, wenn sie auch noch so traurig wirkt, ist niemals depressiv. Musik hat für sich genommen schon eine bejahende Kraft. Es wird die Welt besungen, ein Mensch tönt, es findet etwas statt. Das ist das Gegenteil von Depression. Deshalb liebe ich Musik, Musik hat etwas Grundpositives.
Weder so noch so ist "… e-scooter deine Liebe" wirklich ein Song über Depressionen, egal ob vor, nach oder wegen Corona. Ebenso wenig wie "Die Technik wird uns retten" ein Song über selbstfahrende Automobile sein soll. Das Songthema dient dir jeweils als Rohstoff, der zu Poesie geformt wird.
Wenn du das so wahrnimmst, dem kann ich mich anschließen.
Das ist derselbe Unterschied wie zwischen Bob Dylan und Joan Baez, die ihre Songs in der Regel mit einer Botschaft verband, sich oft selbst ins Gesellschaftsgetümmel begab. Während Bob Dylan zwar auch etwas mitteilte, sich aber eher als Beobachter am Spielfeldrand aufhielt, als Künstler wahrgenommen werden wollte.
Ich wäre dann wahrscheinlich näher bei Bob Dylan. Obwohl ich auch bei ihm denke, allein dadurch, dass er etwas besingt, teilt er etwas mit. Nur eben nicht im Sinne von Joan Baez oder auch Pete Seeger. Eine klare Botschaft fehlt. In den sechziger Jahren ist das sowieso noch etwas anderes gewesen. Vieles zerbröselt einem heute zwischen den Fingern. Mein Song "Marketing" von "Melancholie und Gesellschaft" enthält die Textzeile "Es gibt keine Feinde mehr oder war das andersrum?" Ich meine, es gibt schon noch Feinde, gerade im Moment wird einem klargemacht, wo die rote Linie verläuft. Aber ich bin selbst Teil der Welt, bin selbst Kapitalist, wenn ich mit meiner Band durch die Gegend toure und Geld verdiene, um machen zu können, was ich mache. Zugleich kritisiere ich das, kann aber nie direkt mit dem Finger auf andere zeigen. In vielerlei Hinsicht müsste ich auf mich zeigen. Ein schmaler Grat, die Dinge noch zu benennen.
Wie hat dein kreatives Schaffen eigentlich begonnen, mit Songs oder Textschreiben?
Ich denke, mit beidem. Sprache fasziniert mich, schon als Kind habe ich viel geredet und früh angefangen, Musik zu machen, Texte mit Musik zu verbinden. Bei mir lief das von Anfang an parallel.
Der Literaturbetrieb ist immer in Reichweite geblieben. Mehrere Buchpublikationen sind von dir erschienen, 2007 bist du beim ehrwürdigen Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb im österreichischen Klagenfurt aufgetreten und mit dem 3Sat-Preis als auch dem Publikumspreis bedacht worden.
Damals war gerade mein Album "Lied vom Ende des Kapitalismus" erschienen. Literaturkritikerin Iris Radisch, die in Klagenfurt Jurorin war, lud mich ein. Sie meinte, mach doch mal was. Ich kannte die Veranstaltung gar nicht und schrieb dafür den Text "Die Geschichte meiner Einschätzung am Anfang des dritten Jahrtausends". Das war auch meine erste Begegnung mit Fernsehen, damals bin ich noch gesichtslos unterwegs gewesen. Das Konzept war, es gibt kein Gesicht zu meiner Musik. Die Lesung konnte nur stattfinden, indem ich von hinten oder bis zum Oberkörper gezeigt wurde. Den Kopf sah man nicht. Manche Zuschauer fühlten sich extrem provoziert, sie hielten das für reinen Klamauk. Für mich war gesetzt, dass das nur so funktionieren konnte.
Warum?
Ich hatte Songs geschrieben und stand mit "Sonnendeck" aus meinem Debütalbum "Vierzehn Lieder" plötzlich in der Öffentlichkeit. Ich fragte mich, was machst du jetzt bloß? Was ist das Wahrhaftigste, das Klarste? Was willst du eigentlich? Ich wollte auf gar keinen Fall meine Biographie, mein Gesicht, meine Klamotten versingen. Sondern das sollte für sich stehen, das sollte sein was es ist. Ich bin geprägt durch Musik, zu der ich keine Bilder vom Künstler, von der Band habe. Es gibt Schallplatten, die ich unglaublich oft höre, bei denen ich aber nicht weiß, wie die Musiker überhaupt aussehen. Ich bin dort komplett im Sound drin. Deshalb beschloss ich, dass ich mein Gesicht nicht zeigen werde. Auch als Störelement, dass die Hörer mehr mit sich beschäftigt sind als mit mir, weil sie als Zuhörer sowieso mit sich beschäftigt sind. Dieses Prinzip wollte ich offenlegen. Ich finde es generell schön, Prinzipien offenzulegen. Das begeistert mich. Aber das war schwierig in der Anfangsphase im Umgang mit dem Schallplattenlabel, dem Literaturwettbewerb in Klagenfurt. Dann wurde es als Marke akzeptiert, dass ich der Typ bin, der sich maximal dadurch zeigt, dass er sich nicht zeigt. Wieder etwas später dachte ich, gemäß dem Biermann-Spruch, nur wer sich ändert bleibt sich treu, dass ich vielleicht doch mein Gesicht zeigen sollte.
Populärkultur ist zu gewissen Teilen eine Referenzkultur. Besprechungen deiner Alben, deiner Konzerte erwähnen unter anderem Hölderlin. Fühlst du dich ihm verbunden?
Ja, eine tolle Figur der Popkultur! Ich bin nicht bibelfest, was sein literarisches Gesamtwerk angeht, aber "Hyperion", das brennt so vor sich hin. Man fragt sich, woher das kommt. Dort steckt ganz viel Energie drin. Großartig!
An anderer Stelle wird Molière genannt. Tatsächlich bist du mit mehreren Molière-Adaptionen fürs Theater in Erscheinung getreten.
Ich habe mich intensiv mit Molière beschäftigt, habe Molière-Überschreibungen gemacht, ihn so sehr durch die Mangel gedreht, dass er nicht wiederzuerkennen ist. Meine Stücke sind vom Original weit entfernt. Ich finde Molière toll, das ist großartige Theaterliteratur, ein hervorragendes Sprungbrett, um über Dinge nachzudenken. Die Bühnenstücke sind nicht meine Idee gewesen, das Berliner Maxim-Gorki-Theater fragte an, ob ich mir eine Bearbeitung von "Der Geizige" vorstellen könnte. Wahrscheinlich dachten sie, das würde passen, weil gerade mein "Kapitalismus"-Album erschienen war. Daraus sind drei weitere Stücke entstanden. Ich empfinde eine starke innere Verbindung zu Molière. Er war der Direktor seiner eigenen Company, stand selbst auf der Bühne, gab die Hauptrollen jeweils selbst. Ich bin auch mein eigener Protagonist, bringe mein eigenes Material auf die Bühne. Schon deshalb besteht eine ziemliche Nähe. Molière ist auf der Bühne gestorben, während der den "Eigebildeten Kranken" gab. Was auch so eine irrwitzige Fußnote ist, mir definitiv aber nicht passieren wird, hoffe ich wenigstens.
Jemand entdeckte auch Gemeinsamkeiten mit Niklas Luhmann, dem westdeutschen Soziologen und Schöpfer der Systemtheorie.
Ich finde, der ist ein großer Poet. Ich muss oft lachen, wenn ich Texte von Niklas Luhmann lese. Er hat eine schöne Art, die Welt zu betrachten. Für mich hat das viel mit Buddhismus zu tun, das System als System zu betrachten, das hauptsächlich sich selber betrachtet. Das sind selbsttragende Karosserien, so verstehe ich das Luhmannsche Denken. Ich bin kein Soziologe oder Philosoph, stehe nicht knietief in der Materie, lese aber immer mal seine Sachen.
Würdest du deine Songs als selbstragende Karosserien bezeichnen?
Ja, das ist schon bei jedem Song das Ziel, dass der sich selber trägt. Es gibt kein Chassis wie beim Tin Lizzie, diesem alten Ford-Modell, das wie eine Kutsche aufgebaut war, an einer Bodenplatte die Räder befestigt und der Motor aufgeschraubt gewesen ist, und drum herum wurde eine Haut, eine Karosserie gezogen. Das moderne Auto ist selbstragend, es gibt keine Bodenplatte, das Gehäuse an sich ist die Struktur. Das finde ich interessant, so sollte ein Song sein.
Bliebe noch der Albumtitel zu klären. Wofür das Ibuprofen steht, erschließt sich relativ leicht, das Schmerzmedikament steht für Schmerzbewältigung. Was aber will der Beton uns sagen?
Beton ist eine Metapher für die Unausweichlichkeit, die maximale Verhärtung der Welt. Wir verletzlichen Menschen sind einbetoniert in den Verhältnissen.
Bernd Gürtler SAX 4/21
PeterLicht
"Beton & Ibuprofen"
(Tapete; 5.3.2021)